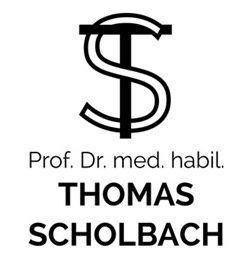- Neue Artikel
- Was Patienten sagen – Fortsetzung
- Praxis/ online Terminvergabe
- Warum die Diagnose einer psychosomatischen Erkrankung häufig eine Fehldiagnose ist
- Gefäßkompressionssyndrome
- Haben Sie Fragen?
- Checkliste Gefäßkompressionssyndrome
- Beschreibung Ihrer Symptome
- Erklärung der geschlechtsspezifischen Unterschiede bei den klinischen Symptomen von abdominalen vaskulären Kompressionssyndromen: Varikozele und Penis-/Hodenschmerzen – ihre Hauptmanifestation bei Männern.
- Die Varikozele wird überwiegend durch eine Kompression der linken Nierenvene verursacht
- Muskuloskelettale Besonderheiten der weiblichen Pubertät
- Lordose /Hohlkreuz – Ursache zahlreicher abdomineller Kompressionssyndrome
- Die Anhebung einer Vene erzwingt deren Kompression
- Truncuskompression bei Kindern
- Lordogenetisches Mittellinensyndrom
- Neurologische Folgen des Mittellinienstauungssyndroms
- Erfolgreiche Behandlung einer Teenagerin, die aufgrund extremer postprandialer Schmerzen nicht essen und aufgrund einer Spastik im linken Bein nicht gehen konnte.
- Schwere Ataxie bei einer jungen Frau mit schwerer venöser Rückenmarksstauung – vollständige Heilung nach Dekompression der linken Nierenvene
- Alle abdominalen Kompressionssyndrome liegen in der Lordose begründet
- Das „Nussknacker“-Syndrom ist eine Fehlbezeichnung
- May-Thurner-Konstellation /May-Thurner-Syndrom/Cockett’s syndrome/Vena iliaca-Kompressionssyndrom
- Mittelliniensyndrom (Stauung der Mittellinienorgane)
- Pelvines Kongestionssyndrom
- Truncus-coeliacus-Kompression / Dunbar-Syndrom / MALS / Ligamentum arcuatum-Syndrom
- Wilkie-Syndrom / Arteria-mesenterica-superior-Syndrom
- Kompression der Vena cava inferior
- Quantifizierung der Gefäßkompressionssyndrome mit der PixelFlux-Technik
- Bindegewebserkrankungen begünstigen kombinierte Kompressionssyndrome
- Posturales Tachykardiesyndrom (POTS) – die hämodynamische Folge von Gefäßkompressionssyndromen und lockerem Bindegewebe
- Unruhige Beine (restless legs) – Folge venöser Kompressionssyndrome
- Pudendusneuralgie bei vaskulären Kompressionssyndromen
- Ein neues sonographisches Zeichen für eine schwere orthostatische Beckenvenenstauung
- Migräne und Multiple Sklerose
- Behandlung von Kompressionssyndromen
- Fehler bei der Therapie von Gefäßkompressionssyndromen
- Embolisation – Irrweg bei venösen Kompressionssyndromen
- Risiken von Stents bei venösen Kompressionssyndromen
- Chirurgische Behandlung von abdominalen Kompressionssyndromen: Die Bedeutung der Bindegewebshypermobilität
- Nutcracker and May-Thurner syndrome: Decompression by extra venous tube grafting and significance of hypermobility related disorders
- Chronisches regionales Schmerzsyndrom (CRPS) verursacht durch Venenkompressionen und mechanische Reizung des Plexus coeliacus
- Vaskuläre Kompressionssyndrome, die ich kürzlich entdeckt habe
- Kaleidoskop lehrreicher Krankheitsverläufe
- Ultraschalldiagnostik
- Leistungsspektrum
- Funktioneller Farbdoppler-Ultraschall – wie ich ihn verstehe
- Durchblutungsmessung – PixelFlux-Verfahren
- Forschung
- Publikationen
- Nutcracker and May-Thurner syndrome: Decompression by extra venous tube grafting and significance of hypermobility related disorders
- Veröffentlichungen von Th. Scholbach
- Eigene Publikationen
- Erstbeschreibung der Bestimmung des Gewebsperfusionsindexes in Nierentranplantaten
- Erstbeschreibung des Mittellininesyndroms – Aspirintherapie
- Erste sonografische Gewebsperfusionsmessung in Nierentransplantaten
- Erste sonografische Tumorperfusionmessung und Korrelation zur Tumoroxygenierung
- Erstmalige Darmwandperfusionsmessung bei M. Crohn
- Erstmalige sonografische Gewebsperfusionmessung der Nieren
- Erstmaliger Nachweis von Frühveränderungen der Nierenperfusion bei Diabetes mellitus
- PixelFluxmessung der Nierengewebsperfusion
- Publikationen
- Expertise
- Bornavirusinfektion
- Wissenschaftliche Zusammenarbeit
- Cookie-Richtlinie
- Hinweise zu medizinischen Erläuterungen
- Datenschutzerklärung
- Cookie Policy (EU)
- Impressum

Eine flache Bauchhöhle prädisponiert zu Gefäßkompressionen-das Zusammenspiel von verstärkter Lordose und flachem Brustkorb
Eine flache Bauchhöhle prädisponiert zu Gefäßkompressionen-das Zusammenspiel von verstärkter Lordose und flachem Brustkorb
Gefäßkompressionssyndrome werden wesentlich durch die verstärkte Lordose der Lendenwirbelsäule ausgelöst, die Gefäße und Abschnitte des Magen-Darm-Traktes nach ventral drängen und sie von dorsal komprimieren. Wenn die Bauchhöhle besonders flach ist, engt die tief liegende Bauchdecke die Bauchhöhle zusätzlich ein. Dies kann vor allem dann bedeutsam werden, wenn sich Darmschlingen oder der Magen nach Nahrungsaufnahme vergrößern und zusätzlich gegen Venen drängen und diese zusätzlich komprimieren.
Ein flacher Brustkorb bei dem die untere Öffnung des Brustkorbes (untere Thoraxapertur) relativ breit aber verhältnismäßig flach ist, kann den Raum in der Bauchhöhle weiter verkleinern. Das Brustbein hat dann nur wenig Abstand zur oberen Lendenwirbelsäule. Da sich die Bauchdecke vom Brustbein und den Rippen zum Beckenkamm und zum Schambein erstreckt, ist die Höhe des Brustkorbes und die Höhe der Beckenschaufeln in diesem Zusammenhang bedeutsam.
Ein flacher Brustkorb führt auch zu einer geringeren Effizienz der thorakalen Atmung. Bei Einatmung werden die Rippen angehoben. Haben die Rippen eine relativ ausgeprägte Krümmung, resultiert ein flacher Brustkorb. Patienten mit Bindegewebsschwäche entwickeln häufig bereits im Kindesalter einen flachen Brustkorb. Möglicherweise gibt der weiche Rippenknochen in Rückenlage der Schwerkraft eher nach. Mir ist nicht bekannt, ob eventuell bereits im Uterus der externe Druck des Fruchtwassers und der Gebärmutter selbst bei Feten mit Bindegewebsschwäche zu einer Behinderung der Tiefenausdehnung des Brustkorbes führt.
Weiter ausladende Rippen führen zu einem weiteren Brustkorb. Bei Einatmung werden die Rippen angehoben. Sind die Rippen besonders stark gekrümmt, erweitert sich der Brustkorb bei der Einatmung relativ wenig. Beschreiben die Rippen einen großen Bogen, hat die Einatmung eine stärkere Erweiterung des Brustkorbs zur Folge. In diesem Fall wird mehr Unterdruck im Brustkorb erzeugt, sodass ein größeres Volumen eingeatmet werden kann.
Auch die Höhe der Beckenschaufeln spielt eine bedeutende Rolle. Ragen die Beckenschaufeln weit nach vorn , heben sie die Bauchdecke an, die Bauchhöhle wird weiter. Ist das Becken dagegen weit und flach, tritt schneller ein räumlicher Konflikt zwischen Darmschlingen und Venen, insbesondere nach Nahrungsaufnahme ein.
Nicht selten beträgt der minimale Abstand zwischen Wirbelsäulenvorderkante und Bauchdecke bei diesen Patienten auf dem Scheitelpunkt der Lordose der Lendenwirbelsäule weniger als 1 cm! Der Darm kann zwar zu großen Teilen nach rechts und links von der Wirbelsäule ausweichen, wo die Bauchhöhle eine größere Tiefe hat. Allerdings muss wegen der Kontinuität des Darmes auch die Wirbelsäule von einzelnen Darmschlingen überquert werden. Dann kann es infolge der geringen Höhe der Bauchhöhle vor der Wirbelsäule dazu kommen, dass zwar bei leerem Darm der Abstrom des Blutes aus dem Becken noch zufriedenstellend funktioniert. Füllt sich der Darm aber und entwickelt dabei normalerweise einen Durchmesser von mindestens 2 cm, kann es bei sehr flacher Bauchhöhle sowohl zur Behinderung des Nahrungstransportes im Darm über die Wirbelsäule hinweg als auch zur zusätzlichen Kompression von Venen vor der Wirbelsäule führen. Diese Patienten berichten dann charakteristischerweise von Schmerzen im Mittel- und Unterbauch etwa 30 Minuten nach Nahrungsaufnahme. Dies ist die Zeitspanne, in der die Nahrung nach Beginn der Mahlzeit bis zum Dünndarm im Mittel- und Unterbauch transportiert wird.
Bei besonders flacher Bauchhöhle leiden auch die Organe im Oberbauch unter dem Platzmangel.
Dann kommt es neben der
- Kompression der linken Nierenvene (sogenanntes Nußknackersyndrom) häufig auch zur
- Kompression der Milzvene bei Überquerung der Arteria mesenterica superior,
- zur Kompression der Vena mesenterica superior beziehungsweise der Wurzel der Pfortader an der Arteria hepatica,
- zur Kompression des Magenausgangs (Antrum pylori) zwischen Aorta und Bauchdecke,
- zur Kompression des Duodenums zwischen Aorta und Arteria mesenterica superior (Wilkie-Syndrom) zur
- Kompression der Vena cava inferior gegen die Arteria renalis dextra,
- zur Kompression der linken Nierenvene durch den Magen,
- zur Kompression des Duodenums durch den Magen,
- zur Kompression der rechten Nierenvene durch das Duodenum und
- zur Kompression der Vena cava am Zwerchfell sowie zur
- Kompression des Truncus coeliacus durch das Ligamentum arcuatum. Weitere Kompressionen sind in seltenen Fällen möglich, wie zum Beispiel die
- Kompression der Nierenarterien durch das Zwerchfell oder die
- Kompression der Arteria mesenterica superior durch das Ligamentum arcuatum, wenn bei starker Lordose die Aorta nach links von der Wirbelsäule abgeleitet, sich dreht und dadurch eine schräge Überquerung der Aorta durch den rechten Zwerchfellschenkel entsteht wodurch die Arteria mesenterica superior exponiert wird. Diese kann normalerweise vom Ligamentum arcuatum nicht erreicht werden, da der Truncus coeliacus kranial der Arteria mesenterica superior aus der Aorta abgeht und zuerst vom Ligamentum arcuatum touchiert wird. In besonders ausgeprägten Fällen kann auch eine doppelte Kompression von Truncus coeliacus und Arteria mesenterica superior durch das Ligamentum arcuatum eintreten.
Die Folgen der Enge der Bauchhöhle sind daher komplex und müssen individuell untersucht werden.
Oft treten auch Kompressionen durch die gleichzeitig verstärkte Lordose der Halswirbelsäule auf. Das sind
- Kompression der Jugularvenen durch den Processus styloideus (Eagle-Syndrom)
- Kompression der Jugularvene zwischen Bulbus der Arteria carotis interna und im Musculus sternocleidomastoideus
- Kompression der Jugularvene in der oberen Thoraxapertur
- Kompression der Vena subclavia zwischen erster Rippe und Schlüsselbein (Thoracic Inlet Syndrom)
- Kompression des Plexus brachialis beziehungsweise der Arteria brachialis (Thoracic-outlet-Syndrom)
Der folgende Fall einer 19-jährigen Patientin mit flachem Thorax und verstärkter Lordose zeigt ein ganzes Spektrum solcher Kompressionen.
Die Patientin konnte oral keine Nahrung mehr aufnehmen und musste über eine perkutane Jejunostomie im linken Mittelbauch ernährt werden. Außerdem litt sie an starken, postprandial betonten Bauchschmerzen, Schmerzen im Genitalbereich (Dyspareunie, Menstruationsschmerzen), Flanken- und Rückenschmerzen links, starken Kreislaufdysregulationen (Effekt der Kompression der Vena cava und des May-Thurner-Syndroms) insbesondere nach der Nahrungsaufnahme. Diese Effekte waren selbst bei Ernährung über die Jejunalsonde noch stark ausgeprägt. Die Patientin hat infolge der Übelkeit, der frühen Sättigung und des häufigen Erbrechens 25 kg Gewicht verloren und wiegt nun 45 kg bei 173 cm Körperlänge (BMI= 15,2). Sie leidet auch an bitemporalen Kopfschmerzen, einer Schwäche beider Beine und Missempfindungen in den Beinen und zahlreichen vegetativen Symptome wie plötzlicher Verfärbung der Haut (rot oder blau), Benommenheit, Atembehinderung, vor allem in der Einatmung mit dem Gefühl der Luftnot. Die Patientin muss häufig kleine Mengen Urin entleeren.
Ihre Symptome begannen schleichend, wurden aber im Sommer 2021 sehr belastend und nahmen weiter zu.
Die folgenden sonografischen Bilder und Videos illustrieren die komplexe anatomische und klinische Situation.
Die Unmöglichkeit, Nahrung oral aufzunehmen beruht im Wesentlichen auf einer straffen Kompression des Duodenums durch die Arteria mesenterica superior und einen ihrer Äste ventral des Duodenums und der Aorta dorsal des Duodenums.
Das Duodenum rennt mit verstärkter Peristaltik gegen die Einklemmung durch Arteria mesenterica superior und Aorta an, ohne Nahrung über die Gefäßklemme transportieren zu können-voll ausgeprägtes Wilkie-Syndrom.
Bereits bei leerem Magen fällt mit hochauflösendem Schallkopf die unüberwindbare Einklemmung des Duodenums ins Auge. Das Duodenum erweitert sich (links im Bild), kann aber die komprimierte pars horizontalis duodeni nicht öffnen (rechts im Bild)
In der Farbdopplersonografie wird deutlich, dass 2 arterielle Gefäße ventral zur Kompression beitragen-die Arteria mesenterica superior und einer ihrer Hauptäste

Dieses Bild zeigt die Aufdehnung des Duodenums auf über 3 cm, bevor die peristaltische Welle den Duodenalinhalt nach medial transportiert. Daher ist die Vena cava inferior (Gefäß links im Bild) noch offen (rechts im Bild Aorta und etwas flau ventral und im Bild links der Aorta die Arteria mesenterica superior).
2. Es fanden sich mehrere Gründe für die postprandialen akzentuierten Oberbauchschmerzen der Patientin. Das oben beschriebene Wilkie-Syndrom, aber auch ein Ligamentum arcuatum Syndrom und weitere Kompressionen die weiter unten beschrieben werden.

Kompression des Truncus coeliacus durch das Ligamentum arcuatum-gelb-grüne Turbulenzen als Zeichen der starken Flussbeschleunigung an der Kontaktstelle mit dem Zwerchfell-flache dunkle Struktur ventral der Aorta.

Flussbeschleunigung im Truncus coeliacus bei Ligamentum arcuatum Syndrom-hier Darstellung in Inspiration nach Rückzug des Zwerchfells (beachte die deutliche Verdickung des nun kontrahierten Zwerchfells). Die systolische Flussgeschwindigkeit übersteigt 3 m/s!

Selbst die Aorta wird durch das straff aufsitzende Ligamentum arcuatum leicht komprimiert. Der Abgang des Truncus coeliacus liegt noch kranial des Hiatus aorticus.

Mit subtilem Power-Doppler kann man sehr schön den eigentlichen Ursprung des Truncus coeliacus 14 mm kranial des Hiatus aorticus als helles Gefäß (beschleunigte Blutströmung) im Vergleich zur dunkleren Aorta (vergleichsweise langsame Blutströmung) darstellen.
Die dauernd bestehendem maximale Kompression der linken Nierenvene führte bei Vergrößerung des Magens nach Nahrungsaufnahme unweigerlich ebenfalls zu Schmerzen, betont im linken Oberbauch.
Die Patientin leidet an einer Maximalform des sogenannten Nussknackersyndroms mit vollständiger Unterbrechung des Blutstroms in der vollständig ventral der Aorta komprimierten linken Nierenvene. Das Nierenvenenblut wird über eine kräftige paravertebrale Kollateralen (Tronc réno-rachidièn) abgeleitet.

Der Blutstrom in der linken Nierenvene (kräftiges rotes Gefäß rechts unten) erlischt zwischen Aorta und Arteria mesenterica superior (quer getroffene, runde Gefäße in Bildmitte)

Die linke Nierenvene (rot-Blutstrom nach ventral) setzt sich nicht weiter nach rechts fort sondern beschreibt eine den vollständigen Bogen (blauer Tronc réno-rachidièn da Umkehr der Blutströmung in Richtung Wirbelsäule)
Eine weitere Ursache von Oberbauchschmerzen ist die Kompression der Milzvene.

Kompression der Milzvene (oben rechts im Bild) bei Überquerung der Arteria mesenterica superior. Unten im Bild Kompression der linken Nierenvene zwischen Aorta und Arteria mesenterica superior.
Die ausgeprägte Kompression der Vena cava inferior, insbesondere nach Nahrungsaufnahme durch das sich aufblähende Duodenum, aber bereits nüchtern durch einen erweitertes Quercolon mit gestörter Peristaltik von ventral und durch die Anhebung der rechten Nierenarterie, die durch die Lordose von dorsal gegen die Vena cava gedrängt wird, verursacht nicht nur Schmerzen im rechten Oberbauch sondern auch Kreislaufstörungen, wenn das Blut der unteren Körperhälfte dann das Herz nicht mehr in ausreichendem Maße erreicht. Die sogenannte Vena cava Syndrom geht einher mit beschleunigten Herzschlag und verminderter Durchblutung des Gehirns. Die Patientin berichtete über Benommenheit.

Kompression der Vena cava bei Überquerung der rechten Nierenarterie (schräg ovale Struktur dorsal der Vena cava)

Längsschnitt der Vena cava mit Kompression von dorsal durch die Wirbelsäule und von ventral durch Darmschlingen.
Kompression der Vena cava inferior durch das sich kontrahierende Kolon transversum von ventral und durch die lordotische Krümmung der Wirbelsäule von dorsal.
Querschnitt der Vena cava zur Veranschaulichung ihrer Kompression durch das Duodenum
Kopfschmerzen werden wesentlich ausgelöst und unterhalten durch Umleitung von Nierenvenenblut über den Tronc réno-rachidièn in den Spinalkanal. Das zusätzliche Blutvolumen steigert den Druck nicht nur im Spinalkanal sondern auch im Schädel.
Die Kreislaufprobleme der Patientin sind erklärbar durch die Verminderung der Auswurfleistung des Herzens mit Verminderung der Durchblutung des Gehirns sobald die Patientin sich hinstellt. Dann zieht die Schwerkraft das Blut verstärkt in die untere Körperhälfte. Durch die gleichzeitige Kompression der linken Beckenvene (May-Thurner-Syndrom) und die Kompression der Vena cava-besonders ausgeprägt nach Nahrungsaufnahme kann das Blut jedoch nicht ausreichend zum Herzen zurücktransportiert werden. Außerdem wird noch Blut über die Vena ovarica sinistra aus der gestauten linken Nierenvene in die Beckenzirkulation eingespeist und verstärkt somit noch das venöse Pooling im Becken. Das Ausmaß des venösen Poolings kann am besten in einer Volumenperfusionsmessung der Aorta ermittelt werden.
Obwohl die Patientin bei der körperlichen Untersuchung keine Zeichen einer Bindegewebsschwäche aufwies, sank infolge des Absinkens der Leber die rechte Niere zum großen Teil bis ins Becken ab.
Die pelvine Kongestion, eine Folge des May Thurner Syndroms und der Kompression der Vena cava, verstärkt durch die Kollateralisierung von Blut aus der gestauten linken Nierenvene über die Vena ovarica sinistra ins Becken, führte zu einer solchen Drucksteigerung in der Vena iliaca communis sinistra, dass die Vena iliaca interna sinistra kein Blut von den Beckenorganen einspeisen konnte. Das Blut dieser Vene wurde über die Mittellinienorgane (Uterus, Scheide, Harnblase-daher die Pollakisurie und Harnröhre) zur rechten Beckenseite umgeleitet.
Das schwere Krankheitsbild der Patientin kann nur angemessen diagnostiziert werden, wenn die Veränderungen in den Blutgefäßen und im Darm funktionell untersucht werden.
Dies bedeutet, dass alle Patienten mit Gefäßkompressionen im Liegen und bei aufrechter Körperhaltung und sowohl vor als auch während und nach der Nahrungsaufnahme komplett untersucht werden müssen. Dafür muss ein Zeitaufwand von 2, manchmal bis zu 4 Stunden eingeplant werden. Anschließend müssen die Flussphänomene mit der PixelFlux-Technik quantifiziert werden. Dies beinhaltet die Auswertung hunderter Bilder aus Videosequenzen.